Einmal noch schwimmen
Die Schmerzen sind zum Verrücktwerden. Hol mich bitte ab und bring mich ins Krankenhaus. Unter solchen Qualen will ich gar nicht mehr leben.
Mama, ich kann hier nicht weg. Ich organisiere dir ein Taxi und komme dann ins Krankenhaus nach. Ruf mich an, sobald du in der Ambulanz bist, damit ich mit der Ärztin oder dem Arzt reden kann.
Eine stationäre Aufnahme wäre hilfreich gewesen. Aber nein: Schmerzmedikation und häusliche Pflege. Die Tochter zerbröselt sich zwischen Job und Fürsorge. Die Brüder fühlen sich nicht zuständig.
Essen auf Rädern. Mobile Hauskrankenpflege. Ein Alltagshelfer, der zur Apotheke geht, die Post vorliest und dergleichen übernimmt. Mobile Fußpflege. Pflegegeld beantragen. Eine Woche Telefonmarathon. Langsam ist alles auf Schiene.
Die Schmerzen vergehen, der Pharmakologie sei Dank.
Kann ich denn überhaupt nichts mehr alleine? Ich sitze hier nur herum. Was kann ich tun? Wie kann ich zu meiner Genesung beitragen? Im Wochenendhaus hätte ich wenigstens den Garten. Meine Freundin könnte mich hinbringen.
Warmes Lächeln erfüllt sie bei diesem Gedanken. Das Wochenendhaus ist ihre Heimat, die Stadtwohnung nur zweite Wahl.
Sie erzählt der Tochter von ihren Plänen. Diese fällt aus allen Wolken. Wie kannst du nur!
Ich dachte, sie freut sich mit mir und redet mir gut zu, dass ich das schaffe und dass mir das gut tun würde. Aber nein.
Sie hatte so viel Arbeit, hat alles organisiert. Ich weiß ja, sie meint es gut. Ich will ja nicht undankbar sein, aber…
Mama, denk an die lange Autofahrt, das wird dir zu viel. Und außerdem. Hier hast du alles und bist schnell im Krankenhaus, wenn es notwendig ist.
Die Tochter fühlt sich verarscht. Ihr ganzes Bemühen, das Organisieren – war das alles umsonst? Wozu habe ich eine Woche lang herumtelefoniert? Jetzt, wo sich Routine einstellen würde, haut die Alte ab. Macht alles zunichte, und ich kann wieder telefonieren um alles abzusagen.
Mir war das alles zu viel. Ich muss zusehen, dass ich es alleine schaffe. Ich will diese Bevormundung nicht.
Die Angst, ihre Autonomie zu verlieren, kroch unter ihre Decke. Zwickte sie hie und da.
Raus hier! Ich kann’s noch! Ich will noch. Meine Selbstbestimmung, lass sie mir bitte!
Der Wille ist stark. Er schenkt Kraft.
Ich will meine Freiheit! Schade, dass ich nicht mehr Autofahren kann. Aber mein Augenlicht. Wenn ich doch wenigstens vom Haus zum See käme, diese paar Meter. Ich möchte so gerne noch einmal schwimmen.
Die Tochter rauft sich die Haare. Ist zu weit weg, um täglich nach dem Rechten zu sehen.
Lass sie halt, meint der Bruder lapidar. Wenn sie es so will.
Der hat leicht reden, der schert sich ohnehin nicht. Beide nicht. Sie kennen zwar Mamas Sturkopf, aber den Ernst der Lage erkennen sie nicht.
Zu gerne wüsste sie die Mutter in Sicherheit. Hat so viele Stunden investiert, um ihr ein einigermaßen autarkes Leben in der Wohnung zu ermöglichen.
Ich weiß ja, dass sie sich Sorgen macht. Ich will ja auch nicht undankbar sein, sie kümmert sich um so vieles. Aber soll ich denn hier sitzen und zusehen, wie immer alles schwieriger wird?
Einmal möchte ich noch im See schwimmen bevor der Herbst kommt. Das wär schön.

Fürsorge die weh tut
Auf welcher Seite findest du dich wieder? Kennst du den Schmerz über den Verlust der Autonomie, oder die Qual über die nicht angenommene Fürsorge?
Vielleicht ist es auch ganz anders.
Aus dem Beratungsalltag kenne ich auch Situationen, in denen sich die Kinder von den Erwartungen der Eltern vereinnahmt fühlen und zwischen Abgrenzung und schlechtem Gewissen pendeln.
Das passende Maß zu finden, ist oft eine Gratwanderung.
Eine System-Aufstellung kann helfen, die wahren Bedürfnisse zu erforschen und gangbare Wege auszuprobieren. Jede Geschichte ist einzigartig.
Schreib über deine Erfahrungen in den Kommentaren, lass uns teilhaben und voneinander lernen.

Spring ins Leben, Herz voraus ❣️
Ich begleite Menschen einzeln und in Gruppen; wenn das Leben eng wird, mit psychologischer Beratung, Systemaufstellungen und Arbeit mit dem Inneren Kind. Mein Ansatz: Selbstliebe zuerst. Innere Ordnung schafft ehrliche Beziehungen. Geborgenheit im Inneren ermöglicht Souveränität im Außen.
Ich schöpfe aus meinem über 20-jährigen Erfahrungsschatz und arbeite in Linz und online. Mehr über mich erfährst du hier!
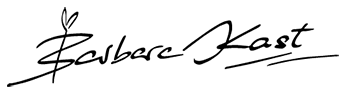





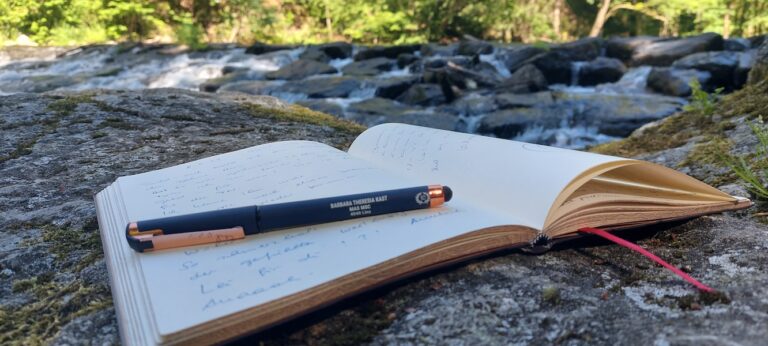
3 Kommentare
I deeply relate to the struggle of losing autonomy and the complex emotions towards supportive but overbearing family members. The article hits close to home in highlighting the delicate balance between care and independence.