Ich doch nicht!
Menschen mit psychischen Problemen oder psychischen Erkrankungen haben meist eines gemeinsam: Sie schämen sich ihrer selbst.
Nicht nur von vielen Klientinnen ist mir das bekannt, ich kenne es auch aus eigener Erfahrung.
Mittlerweile ist es mehr als 10 Jahre her, dass ich mich in einer tiefen psychischen Krise befand. Noch nie habe ich darüber öffentlich geschrieben und ich merke, es fällt mir auch heute noch nicht leicht.
Burnout und Depression
In diesem Artikel erzähle ich eine persönliche Geschichte mit der Erkrankung, vom Nicht-Wahrhaben-wollen hin zu dem langen Weg der Genesung. Gespickt mit Erfahrungen anderer und Basiswissen, über Depression und Burnout.
Der Text ist für
Betroffene, Angehörige und psychosoziale Fachkräfte.
Wenn ich an den Aufenthalt in der Psychiatrie zurück denke, ist mir der eine Satz am stärksten in Erinnerung:
„Ich doch nicht!“
Ein Steh-auf-Weibchen
Ich doch nicht, ich, die anderen zeigt, wie es geht. Ich, die tausend Methoden kennt, um ins emotionale Gleichgewicht zu kommen, die Strategien an der Hand hat, um sich selbst zu regulieren.
Heute, mit etwas Abstand, stelle ich fest: Gerade die vielen Tools und Strategien haben mich viele Jahre getragen, haben es mir immer wieder ermöglicht aufzustehen. Denn in Wirklichkeit war ich schon all die Jahre unzählige Male kurz vor dem Burnout.
Umfallen war keine Option: Wenn ich ausfalle, steht die Mühle.
Meine Weiterbildung war mir stets wichtig. Jedem Seminar ging Abwägen und Organisieren voraus: Kann ich die Mädels schon wieder alleine lassen? Wer schaut auf sie? Wer kocht, wer bringt sie von A nach B, wenn ich nicht da bin? Jede Abwesenheit war vom schlechten Gewissen begleitet. Heute weiß ich, dass schlechtes Gewissen niemanden hilft, destruktiv ist und unnötig Energie verprasst. Innere Zerrissenheit ist eine Zutat für den Burnout-Cocktail.
Zu lange zu viel Verantwortung
Meine Kinder waren 10, 12 und 15, als ich 2005 meinen damaligen Mann verließ. Als Bäuerin hatte ich mit ihm einen kleinen Hof bewirtschaftet. Der Abschied hatte sich über Jahre dahin gezogen, in denen mein Mann immer mehr dem Alkohol verfiel.
Ich dachte, es sei alleine leichter, als neben einem Alkoholiker und mußte dann feststellen: Die volle Verantwortung für drei Pubertierende zu tragen, ist eine Mammutaufgabe.
Sechs Jahre später waren die Pubertätsstürme vorbei. Alle drei Töchter beendeten im selben Jahr ihre Ausbildung, traten ins Berufsleben ein und bezogen ihre eigenen Wohnungen.
Beim Blick zurück fällt mir auf: Solange ich für meine Kinder da sein musste, mobilisierte ich immer wieder Reserven, um zu funktionieren, um das Schiff zu steuern. Mal war die See rauh, mal ruhiger, die Kapitänin ließ nie das Steuer in der Hand.
Der Dampfer (der hieß: „Kinder groß ziehen“) lag vor Anker. Nun, da die Mädels ihre eigenen Wege gingen, lüftet sich die Ankerkette, und das Schiff trieb am offenen Meer. Tausend Möglichkeiten. Wie lange hatte ich mich darauf gefreut, und dann kam das so plötzlich.
Kein Boden mehr unter den Füßen
Es war der 4. Oktober 2011, ein paar Tage nach der Beerdigung meiner Schwester. Ich hatte zuvor in einem Teilzeitjob Stunden reduziert, um einen zweiten parallel dazu anzunehmen – als Kursleiterin in einer AMS-Maßnahme. Jahre zuvor hatte ich mir versprochen, nie wieder im arbeitsmarktpolitischen Kontext zu jobben.
Sich selbst untreu zu werden, rächt sich.
Es gab so einiges an den Rahmenbedingungen zu kritisieren. Ich beriet mich mit meiner Supervisorin. Sie bestärkte mich, dass ich mich auf die Füße stellen sollte und mitteilen, dass unter solchen Bedingungen kein produktiver Kursablauf möglich sei.
Rien ne va plus
Am nächsten Morgen wurde das Aufstehen zum Kraftakt. Beim Gedanken ans Arbeiten wurde ich von Weinkrämpfen erfasst. Ein Häufchen Elend schaute mich aus dem Spiegel an. „Ich kann mich nicht auf die Füße stellen, denn es gibt keinen Boden mehr unter den Füßen.“
Ich meldete mich krank. Es war mir nicht gelungen, das Weinen während des Telefonats zu unterdrücken. Da war sie wieder, diese Scham, die mich fortan sehr lange würde begleiten.
Schon Tage zuvor, bei der Beerdigung meiner Schwester, wurde ich von Weinkrämpfen gebeutelt. So sehr ich es auch versuchte, ich konnte nicht aufhören – „es weinte mich“, ohne dass ich es stoppen konnte.
Meine Kinder saßen neben mir in der Kirche, ich spürte ihre Ratlosigkeit, spürte, wie unangenehm es für sie war. Es tat mir so leid für sie, ich schämt mich zu Tode.
Das wird schon wieder
Ich braucht eine Krankschreibung. Da ich kurz zuvor umgezogen war (zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres), musste ich einen neuen Arzt finden. Unfähig, der Sprechstundenhilfe meine Adresse oder meine Telefonnummer mitzuteilen, grub ich nach einer Visitenkarte in meiner Tasche. Die Ziffern waren mir partout nicht eingefallen, wie peinlich.
Der Arzt hörte mir nicht zu und schickte mich mit den Worten: „Das wird schon wieder“ nach Hause. An das Entsetzen im Gesicht der Sprechstundenhilfe, als ich die Ordination verließ, erinnere ich mich noch deutlich.
Die Rolle der Starken
Mehrere Tage suchte ich nach Unterstützungen, um wieder auf die Beine zu kommen. Unter anderem suchte ich die Krisenhilfe auf. Nachdem ich „stark sein und keine Schwäche zeigen“ über viele Jahre einstudiert und trainiert hatte, spielte ich diese Rolle auch beim Gespräch in der Krisenhilfe. Mir wurden Gesprächstermine angeboten.
Stärke zeigen, wenn keine mehr da ist, ist fatal.
Buchstäblich mit letzter Kraft schleppte ich mich nach Hause ins Bett. Ich verurteilte mich, weil ich dem Psychologen etwas vorgespielt hatte. Ich brauchte Hilfe. Das Gedankenkarussell drehte sich: Soll ich meinen ehemaligen Hausarzt anrufen? Oder meine Freundin A? Oder meine Tochter B? Oder, oder …
Das Karussell drehte sich immer schneller und immer mehr Möglichkeiten setzten sich auf die Sesseln des Ringelspiels. Es war mir nicht möglich eine Entscheidung zu treffen, bis ich irgendwann „Hilfe“ in eine Textnachricht tippte.
In den folgenden Tagen wurde ich von Töchtern und Freundinnen mit Essen beliefert, ich war unfähig mich selbst zu versorgen. Nach einer Woche brachte mich eine Freundin ins Krankenhaus. Dafür bin ich ihr heute noch unsagbar dankbar. Sie hatte selbst Jahre zuvor eine depressive Episode erlebt und wusste was zu tun war.
Später habe ich von mehreren Menschen erfahren, dass sie jemanden gebraucht hätten, der für sie ärtztliche Hilfe organisiert. Die Depression macht entscheidungsunfähig. Für Angehörige ist es oft nicht nachzuvollziehen wie es den Betroffenen geht. Eine meiner Klientinnen meinte, sie sei heute noch auf ihren Mann sauer, dass er sie nicht ins Krankenhaus gebracht hat. „Er hätte es wissen müssen.“
Das überforderte Umfeld
Angehörige können keine Diagnose stellen. Die wenigsten Menschen haben Erfahrungen mit Depressionen und können die Lage kaum subjektiv beurteilen. Zudem kommt die Erkrankung ja nicht über Nacht, sondern schleichend, in Wellen, mit vielen Auf und Abs. Stimmungsschwankungen gehören zum Krankheitsbild. Betroffene kommen am Morgen kaum aus dem Bett. Im Laufe des Tages wird die Stimmung besser, am Abend „geht’s eh ganz gut.“
Suizide passieren deshalb meistens am Abend, weil da genügend Kraft vorhanden ist. Von Depression geplagte Menschen wissen darum und haben Angst, dass sie sich am nächsten Morgen wieder elendiglich fühlen werden.
Und ein weiteres Thema kommt hinzu: Auch Angehörige schämen sich. Ein Klient erzählt mir, dass er während einer depressiven Episode, auf Drängen seiner Lebensgefährtin, Montag bis Freitag in seiner Dienstwohnung verbracht hatte. Die Nachbarn sollten nicht mitbekommen, dass er nicht arbeitet. Das würde ihr Ansehen stören.
In „Trübsal blasen“ habe ich meine Geschichte über Scham und Schande literarisch verarbeitet.
Aufenthalt Psychiatrie
Auch über meinen Weg in die Klinik hatte ich vor langem eine Geschichte geschrieben, die ich jetzt in meine m Blog veröffentlicht habe: „Reset: Aufnahme Psychiatrie.“ Das Schreiben in der dritten Person ermöglicht, eigene Erlebnisse mit Abstand zu beleuchten.
Die Ärztin hörte mir zu, zeigte Verständnis. Ich konnte mir meine Geschichte selbst kaum glauben, ich war so weit von mir entfernt. Die Ärztin glaubte mir. Bei der Frage nach Suizidgedanken flunkerte ich. Zu groß war die Angst, dass ich auf die geschlossene Abteilung aufgenommen werden würde.
Der Aufenthalt auf der Psychiatrie erinnerte mich mehr an das Internat meiner Jugendzeit. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Schulzeit im Internat sehr genossen hatte.
Das Zimmer war wohnlich eingerichtet, zwei Betten standen an der Wand. Patienten und Patientinnen trugen Alltagskleidung. Zum Essen trafen wir uns im Aufenthaltsraum. Der Tag war gefüllt mit Therapien, von Bewegung über Entspannung, Boxen, Musiktherapie – zahlreiche Angebote, die mich stärkten. Und es war immer jemand da, der mir verständnisvoll zuhörte, wenn ich Bedarf hatte. Es war das erste mal in meinem Leben, dass ich mich um nichts kümmern musste.
„Wenn ich gewusst hätte, dass es mir hier so gut geht, hätte ich mich nicht so lange gesträubt, herein zu gehen.“
Die Skepsis gegenüber Psychopharmaka
Über jedes Medikament diskutierte ich mit dem Oberarzt. Er nahm meine Bedenken ernst. Ich erinnerte mich gut daran, was ich während des Studiums über Psychopharmaka gelernt hatte. Wenn Botenstoffe im Gehirn nicht mehr ausreichend vorhanden sind, hilft reden nicht mehr. Damit der neuronale Spalt zwischen den Nervenenden überbrückt werden kann, brauchen wir Serotonin. Bei einem Mangel dieses Botenstoffes können Signale zwischen Nervenzellen nicht übertragen werden, was unter anderem zu depressiver Stimmung führt.
Im Laufe meiner Krankheitsgeschichte prognostizierten mir mehrere Ärzte, ich müsse diese Medikamente mein Leben lang nehmen. Sie behielten nicht recht. Nach zwei Jahren konnte ich sie, begleitet von meiner Psychiaterin, absetzen.
Der lange Weg zurück
Während meines Klinikaufenthalts erhielt ich von beiden meiner Jobs die Kündigung. Es wäre hilfreich gewesen, in eine gewohnt Arbeitsstruktur zurückkehren zu können. Aber so folgte ein langer Krankenstand. Einmal monatlich musste ich mich vor der Chefärztin der Versicherung rechtfertigen, warum ich noch immer nicht arbeitsfähig bin. Häufig verließ ich diesen Kontrolltermin beschämt und weinend. Eine Erfahrung, die ich mit vielen Betroffenen teile, wie ich heute weiß.
Nach einem Jahr galt ich als „ausgesteuert“, die Versicherungsleistungen waren zu Ende und damit auch die erniedrigen Kontrollbesuche. Mein großes Glück war, dass ich durch die gewerbliche Versicherung aus selbständiger Tätigkeit aufgefangen wurde. Ich bekam Rehageld mit der Auflage, Psychotherapie zu machen.
Ich musste mich nicht mehr monatlich rechtfertigen, erst dadurch wurde ein ungestörter Heilungsprozess möglich. Nach einem Jahr resümierte ich: „Jetzt erst erkenne ich, wie schlecht es mir gegangen ist“, um nach einem weiteren Jahr, dasselbe noch einmal tiefer zu erkennen.
Vertrauen in Psychotherapie
Selbsterfahrung ist Teil der Ausbildung zur psychosozialen Beraterin. Während dem Studium hatte ich die Anzahl der Pflichtstunden bei einer Psychotherapeutin absolviert. Ich konnte in meiner Krise darauf aufbauen. Das Vertrauen war bereits hergestellt und wir konnten sofort zu Arbeiten beginnen.
Von mehreren Menschen habe ich erfahren, dass es für sie unmöglich war, in einer Krisensituation einen passenden Psychotherapieplatz zu finden.
Der Vertrauensaufbau in der Psychotherapie braucht Zeit. Schließlich geht es um unser ureigen Innerstes. In einer akuten Krise überfordert das viele. Deshalb sollten wir alle eine Therapeutin oder einen Therapeuten des Vertrauens an der Hand haben, genauso wie wir unseren Hausarzt / unsere Hausärtzin brauchen. Mit 40° Fieber einen Arzt zu suchen, ist zu viel verlangt, da sollte die Telefonnummer eingespeichert sein. Genauso sehe ich es mit der Psychotherapie.
Unterschied Burnout und Depression
Burnout ist im ärztlichen Sinne keine definierte Krankheit. Die Symptome werden ähnlich beschrieben, wie bei einer Stressdepression (früher Erschöpfungsdepression).
Ursachen und Auslöser können unterschiedlich sein. Burnout-gefährdet sind auch Menschen, die sich gezwungen fühlen, Dinge zu tun, die ihren Werten nicht entsprechen.
Handle nie gegen dein Herz,
damit zerstörst du dich selbst!
Ursache einer Depression können unterschiedliche sein: Neben Stress und Trauma-Erfahrungen können auch ein gestörter Hirnstoffwechsel, Störungen im Hormonhaushalt (zB Schilddrüse), genetische Faktoren oder Medikamente Auslöser einer Depression sein. In vielen Fällen kumulieren mehrere Faktoren.
Burnout, also das Ausgebrannt sein, auf Grund von körperlicher und/oder psychischer Überforderung, kann, muss aber nicht zwangsläufig zu einer Erschöpfungsdepression führen.
Das Wort „Burnout“ klingt meist weniger stigmatisierend als „Depression“. Das persönliche Erleben ist in jedem Fall unangenehm, egal wie es bezeichnet wird.
Im medizinischen Jargon wird von „depressiver Episode“ gesprochen. Diese Bezeichnung nimmt der Krankheit ihre Endgültigkeit. Die Depression kommt in Wellen, sowohl im Tagesverlauf, wie auch im Lebenslauf. Bei manchen einmal, zweimal, bei anderen immer wieder.
Oft unerkannt ist die Altersdepression. Das Bedauern über den Verlust von Autonomie und Agilität sowie Einsamkeit sind mögliche Auslöser. Die Erkrankung bleibt häufig unerkannt da die Symptome bei älteren Menschen als normal angesehen werden.
Allen, an Depression erkrankten, ist noch eines gemeinsam: Sie glauben nicht daran, dass es wieder besser wird. Diese Information brauchen sie von außen.
Die Lernerfahrung
Auch nach mehr als zehn Jahren fällt es mir nicht leicht, über diesen Teil meiner Geschichte zu sprechen.
Manchmal klingt in meinem Kopf ein abgewandelter biblischer Satz nach: „Anderen hat sie geholfen, sich selbst konnte sie nicht helfen.“
Ich merke, dass ich immer noch dabei bin, der Scham keinen Platz zu geben. Die Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist leider immer noch Realität – oft subtil, manchmal ganz offen.
Sätze wie „Lass es dir gut gehen und freu dich doch des Lebens“ sind für Menschen in einer depressiven Phase purer Hohn. Niemand würde zu jemandem mit einem gebrochenen Bein sagen: „Geh einfach spazieren, dann wird es besser.“Doch genau so klingen viele gut gemeinte Ratschläge, wenn die Seele verletzt ist.
Ich habe zwei Studienabschlüsse. Und doch habe ich durch diese Krise mindestens genauso viel gelernt wie in meinen beiden Masterstudien. Vielleicht sogar mehr – über das Leben, über Verletzlichkeit, über mich selbst.
Wenn uns das Leben uns aus der Bahn wirft, beginnt das wahre Lernen. Da fällt mir wieder der gute Hermann Hesse ein:
„Mit den Jahren wird man immer weiser.“
Hermann Hesse
Ich freu mich sehr, wenn du mir deine Gedanken oder Erfahrungen in den Kommentaren mitteilst.
Zum Weiterlesen:
Serotonin-Wirkung auf Psyche, Gehirn, Schlaf, Blutdruck, Gefäße und Darm
https://www.oberbergkliniken.de/krankheitsbilder/depression/erschoepfungsdepression
Während der Krise habe ich meine Geschichte literarisch verarbeitet. Die Verwendung der dritten Person ist ein gängiges Mittel, um die eigene Betroffenheit mit etwas Abstand zu betrachten.

Spring ins Leben, Herz voraus ❣️
Ich begleite Menschen einzeln und in Gruppen; wenn das Leben eng wird, mit psychologischer Beratung, Systemaufstellungen und Arbeit mit dem Inneren Kind. Mein Ansatz: Selbstliebe zuerst. Innere Ordnung schafft ehrliche Beziehungen. Geborgenheit im Inneren ermöglicht Souveränität im Außen.
Ich schöpfe aus meinem über 20-jährigen Erfahrungsschatz und arbeite in Linz und online. Mehr über mich erfährst du hier!
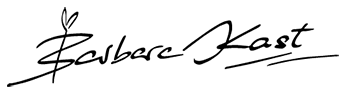



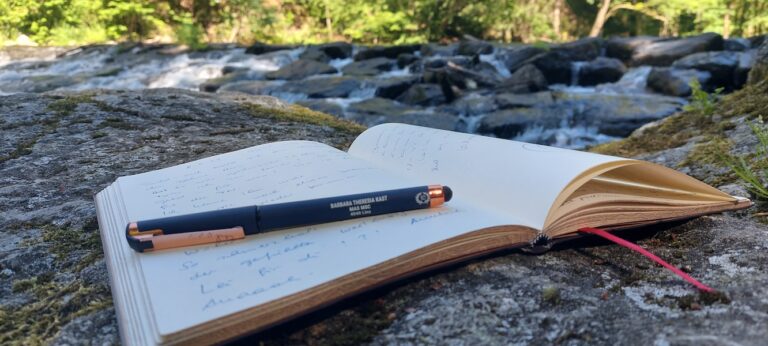


10 Antworten
Liebe Barbara, vielen Dank für diesen wertvollen Einblick. Natürlich habe ich schon viel von Depression gehört, aber zum Glück noch keine persönlichen Berührungspunkte. Ich habe also sehr vieles von dir gelernt. Vor allem weiß ich jetzt, dass ich sofort eine Freundin schnappen, und sie ins Krankenhaus bringen würde.
Liebe Karin!
Vielen lieben Dank für deine Zeilen.
Inzwischen ist es leider so, dass manchmal das KH keine Aufnahme macht. Aber es gibt ja auch andere Hilfsangebote. Wichtig ist zu wissen, dass Menschen in akuter Krise nicht handlungsfähig sind und keine Entscheidungen treffen können. Sie brauchen Unterstützung wie ein unmündiges Kind.
Alles Liebe, Barbara
sehr schöner Artikel, würde ihn gerne auf meinem ähnlichen Artikel verlinken
Liebe Laila! Gerne! Ich wollte dir einen Kommentar hinterlassen, aber das geht auf deiner Website leider nicht. Du beschreibst das so schön, die Ruhe, der Moment der Präsenz – egal was rundherum passiert. Ich weiß, genau das ist es, was Menschen hilft: vollkommende Präsenz.
Alles Liebe, Barbara
Liebe Barbara,
dein Artikel spricht mich auf so vielen Ebenen an. Es ist mutig und unglaublich kraftvoll, wie du deine eigene Geschichte von langer Verantwortung, Überforderung und dem langsamen Weg in eine psychische Krise so ehrlich und klar mit uns teilst.
Schon mit dem Einstieg „Ich doch nicht!“ hast du diesen Moment eingefangen, in dem man realisiert, dass das eigene ‚Ich doch nicht‘ längst zur Realität geworden ist – und wie schwer es ist, das anzuerkennen.
Das erlebe ich auch so häufig in der Arbeit mit meinen Klient*innen.
Und dann kommt – wie du es so eindringlich schilderst – die Scham ins Spiel. Du machst sichtbar, wie sehr Menschen mit Burnout oder Depression diesen inneren Kampf führen – gegen das Gefühl, man sei schwach, unfähig, nicht mehr die Person, die man sein wollte. Und wie befreiend es ist, wenn sich irgendwann das Gefühl einstellen darf, „okay“ zu sein mit allem, was gerade ist.
Vielen Dank, dass du nicht nur dir selbst Raum gibst, sondern auch vielen anderen eine Stimme.
Sehr herzlich
Pia
Liebe Pia!
Anerkennen was ist = die Königsdisziplin 😅 – immer wieder, egal worum es geht.
Vielen lieben Dank für deine Zeilen.
Herzlichst, Barbara